Infobroschüre zu Metastasiertem Brustkrebs
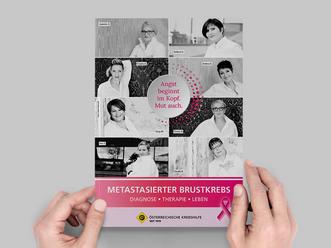
Informationen zum Metastasierten Brustkrebs liefert diese Krebshilfe-Broschüre.
Jetzt Infobroschüre herunterladen!

Brustkrebs ist eine der häufigen Krebserkrankung der Frau. Auch bei Männern ist Brustkrebs möglich, jedoch eher selten.
Bei Brustkrebs (Mammakarzinom, Mamatumor) handelt es sich um eine bösartige Veränderung des Brustgewebes. Ein Verdacht auf Brustkrebs muss in jedem Fall durch entsprechende Diagnoseverfahren abgeklärt werden. Dabei kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz. Erhärtet sich der Verdacht auf Brustkrebs, wird das weitere individuelle Vorgehen besprochen, damit nach den besten derzeit verfügbaren Standards behandelt und betreut wird.
Wichtig ist die Behandlung von Brustkrebs in ausgewiesenen und zertifizierten Brustgesundheitszentren.
Therapie: Wie bei anderen Krebsarten lassen sich auch beim Brustkrebs verschiedene Formen unterscheiden. Die Feststellung des Tumorstadiums ist für die individuelle Behandlungsstrategie wichtig. In den meisten Fällen ist ein chirurgischer Eingriff notwendig. Diese Operation wird heutzutage nach Möglichkeit brusterhaltend durchgeführt. Zusätzlich steht heute dank der modernen Medizin eine breite Palette weiterer therapeutischer Maßnahmen zur Verfügung. Welche Behandlung notwendig ist, und ob diese Therapie vor oder nach der Operation stattfindet, hängt vom jeweiligen Brustkrebs-Subtyp ab.
Informationen zu Metastasiertem Brustkrebs finden Sie hier auf der Krebshilfe-Website sowie in der Krebshilfe-Broschüre "Metastasierter Brustkrebs".
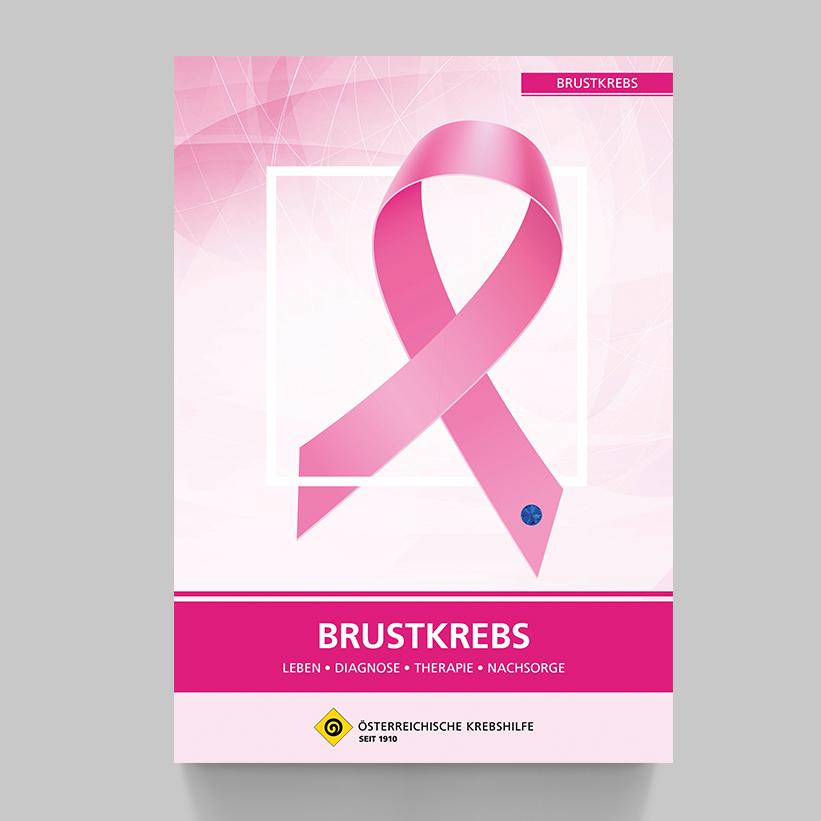
Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Brustkrebsformen sowie zu Diagnose, Therapie und Nachsorge erhalten Sie in der Krebshilfe-Broschüre „Brustkrebs“.
Jetzt Broschüre herunterladen!
In zertifizierten, interdisziplinären Brustgesundheitszentren besprechen Radiolog:innen, Gynäkolog:innen, Chirurg:innen, Strahlentherapeut:innen und Patholog:innen die beste operative oder medikamentöse Erstbehandlung. Nach der Operation wird in diesem Gremium über die weitere umfassende Therapie beraten und beschlossen. Auch begleitende Maßnahmen wie Rehabilitation etc. werden darin besprochen.