Infobroschüre zu Bewegung bei Darmkrebs
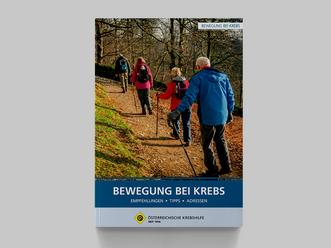
Ausführliche Informationen über regelmäßiges Ausdauertraining bei Darmkrebs gibt die Krebshilfe-Broschüre „Bewegung bei Krebs“.
Jetzt Infobroschüre herunterladen!

Spricht man von Darmkrebs ist fast immer eine Krebserkrankung des Dickdarms (Kolonkarzinom) oder des Mastdarms (Rektumkarzinom) gemeint. Dabei geht der Krebs zumeist von der Schleimhaut, die den Darm innen auskleidet, aus. Krebserkrankungen des Dünndarms kommen sehr selten vor. Über 90% aller Darmkrebserkrankungen entstehen durch Entartung von Darmpolypen.*
Bei der Therapieplanung steht die vollständige Entfernung des Tumors durch eine Operation im Vordergrund. Neben der Operation stehen noch weitere Therapiemöglichkeiten wie z.B. Strahlen- oder Chemotherapie sowie neuere Behandlungsformen wie zielgerichtete Therapien und Immuntherapien mit monoklonalen Antikörpern zur Verfügung. Diese modernen Therapieoptionen haben die Prognose der Erkrankung wesentlich verbessert. Welche Behandlung notwendig ist, ergibt sich aus der Auswertung aller Untersuchungsergebnisse. Es gibt in Österreich zahlreiche Krankenhäuser, die auf Darmkrebs spezialisiert sind.
* Die wirksamste Vermeidung von Darmkrebs ist daher die regelmäßige Entfernung von Darmpolypen. Diese kann im Rahmen einer Koloskopie durchgeführt werden. Für Männer und Frauen ab dem 45. Lebensjahr wird eine Koloskopie zur Darmkrebsvorsorge zumindest alle 10 Jahren sowie ein FIT-Stuhlbluttest (zumindest alle 2 Jahre) empfohlen. Informationen zur Darmkrebsvorsorge finden Sie hier in der Krebshilfe-Broschüre "Darmkrebsvorsorge". Eine Auflistung allerStellen mit einem Qualitätszertifikat Darmkrebsvorsorge finden Sie hier.
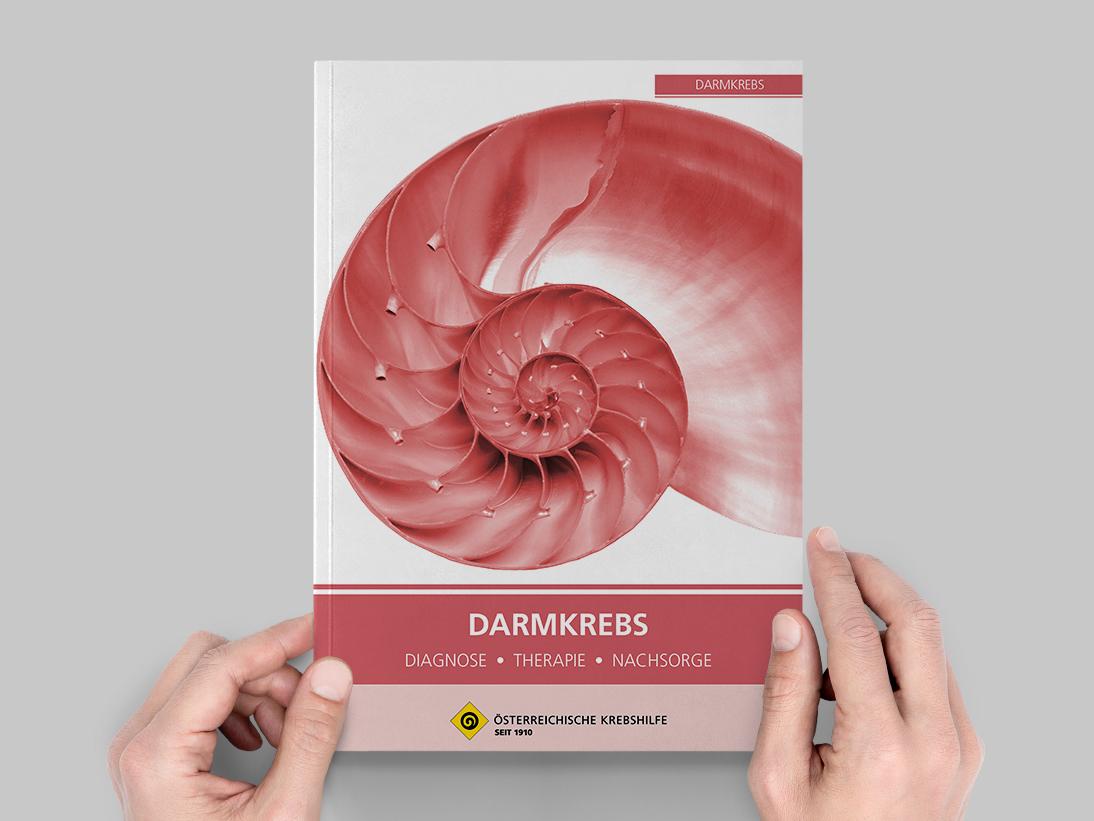
Ausführliche Informationen zu Diagnose, Therapie und Nachsorge von Darmkrebs erhalten Sie in der Krebshilfe-Broschüre „Darmkrebs“.