Eierstockkrebs
Eierstockkrebs ist eine bösartige Erkrankung, die von Zellen des Eierstocks ausgeht: Bösartige Zellen haben die Kontrolle über ihr Wachstum verloren und breiten sich in der unmittelbaren Umgebung, speziell über das Bauchfell der umliegenden Organe, die Lymphgefäße und später über das Blutgefäßsystem aus. Eierstockkrebs ist auch unter dem Namen Ovarialkarzinom bekannt.
Die Risikofaktoren für die Entstehung von Eierstockkrebs kann man in 3 Gruppen einteilen: vererbbare*, hormonelle (endokrine) oder – in seltenen Fällen – durch krebserregende Stoffe. Derzeit gibt es leider keine etablierte Früherkennungs-Untersuchung für Eierstockkrebs.
Die Behandlung von Eierstockkrebs sollte in zertifizierten gynäkologischen Zentren erfolgen. Eine Auflistung aller Zentren finden Sie hier.
Die Behandlung von Eierstockkrebs entspricht einem mehrsäuligen (multimodalen) Konzept und besteht im Grunde aus 3 Bestandteilen:
- operative Entfernung von Tumorabsiedelungen
- Chemotherapie
- zielgerichtete Behandlung
Welche Behandlungsoptionen eingesetzt werden, hängt u.a. von Art und Stadium des Tumors an.
*Hinweis: Eine erbliche Ursache liegt bei ca. 15 % aller Eierstockkrebserkrankungen vor. Wann eine genetische Beratung und Testung empfohlen wird, erfahren Sie in dieser Broschüre auf Seite 17.
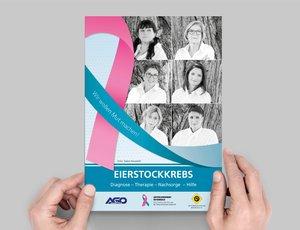
Broschüre Eierstockkrebs
Ausführliche Informationen zu Diagnose, Therapie und Nachsorge von Eierstockkrebs erhalten Sie in der Krebshilfe-Broschüre „Eierstockkrebs“.
